| |
Johannes
Frauendorf
schreibt
in
"Die
Zinnfigur
-
Monatsschrift
für
Freunde
und
Liebhaber
von
Zinnfiguren,
Trachten,
Geschichte
und
Völkerkunde;
Jahrgang
1929,
Heft
Nr.
1":
De
neie
Dybe.
Wie
is
das
jetzt
scheen
eingerich't
Wenn
mr
de
Bundeszeitung
kricht
-
Wo
uns
de
Sammler
gleich
erzähl'n
Was
noch
fir
neie
Dyben
fehl'n.
So
nimmt
mr
flink
e
Schtickchen
Schiefer,
Erscht
gratzt
mr
flach,
dann
schticht
mr
tiefer
-
Un
mit
viel
Aerger
un
Verdruß
Kommt
mr
zum
erschten
Prowe-Guß.
Is
dann
das
Ding
zur
Welt
gebracht,
Brennt
mr
ne
Pfeife
an
un
-
lacht.
De
"neie
Dybe"
es
geboren,
Es
klingt
mr
schon
in
beeden
Ohren;
Was
Auerbach
wohl
davon
hält?!?
Er
is
doch's
Schprach-Rohr
unsrer
Welt
Mr
denkt
schon
an
die
vielen
Kunden
Un
macht
gleich
fufz'n
Ieberstunden.
De
"Neie"
wird
de
Welt
erschittern
-
Un
ooch
de
Konkurrenz
zerschplittern.
-
De
Sammler
sin
ooch
ganz
begeistert;
"Das
hätt
ich
wundervoll
gemeistert;
Wie
diese
"Neie"
wär
noch
keine
-
Bitte,
senden
Sie
noch
e
i
n
e".
E
Andrer
kooft
uff
e
e
n
m
a
l d
r
e
i
e
!
-
Nee,
wie
ich
mich
da
bloß
-
"freie"!
|
| |
K.-H.
Winkelmüller
schreibt
in
der
Zinnfigur
1955:
30
Jahre
Frauendorfsche
Gravierwerkstätte
Am
15.
April
1925
machte
sich
Johannes
Frauendorf
selbständig.
Zu
den
"Mitschuldigen"
gehört
u.
a.
auch
mein
Vater,
denn
er
redete
ihm
noch
gut
zu.
"Natürlich,
angefangen,
und
haben
Sie
keine
Bedenken!"
Doch
zuvor
soll
die
"bewegte
Vergangenheit"
des
Mannes
unter
die
Lupe
genommen
werden,
der
damals
vor
30
Jahren
in
Leipzig-Lindenau
sich
selbständig
machte.
Geboren
wurde
er
am
22.
April
1889
in
Leipzig,
in
jener
Stadt
also,
die
für
die
Zinnfigur
von
jeher
von
ausschlaggebender
Bedeutung
gewesen
ist.
Man
gestatte
uns
eine
kleine
Abschweifung
und
Erinnerung
an
Otto
E.
Gottstein,
der
von
hier
aus
der
Zinnfigur
eine
neue
Richtung
wies
und
die
I.
Internationale
Zinnfiguren-Ausstellung
veranstaltete,
an
den
Hersteller
plastischer
Fahrzeuge,
Ernst
Wolfram,
den
verstorbenen
Graveur
Thieme,
an
Professor
Rössner,
der
in
Leipzig
ins
Examen
(Abitur)
stieg
und
durchfiel
(er
wird
uns
diese
Indiskretion
nicht
verübeln,
denn
inzwischen
hat
er
tausendfach
seine
Reife
bewiesen),
an
Karl
Alexander
Wilke
der
von
hier
aus
seinen
bedeutungsvollen
Weg
ging
und
-
last
not
least
-
sei
auch
unser
"Nachwuchsgraveur"
Franz
Karl
Mohr
erwähnt.
Damals
aber,
als
der
kleine
Hannes
im
Hause
des
Hotels
"Sachsenhof"
das
Licht
der
Welt
erblickte,
wußte
er
noch
nichts
vom
Zinn
und
jener
gefährlichen
"Zinnvergiftung",
die
ihn
36
Jahre
später
befallen
und
nie
wieder
loslassen
sollte.
Nachdem
er
vier
Jahre
die
Volks-
und
weitere
vier
Jahre
die
Bürgerschule
besucht
hatte,
kam
eine
vierjährige
Lehrzeit
als
Reliefgraveur.
Er
begnügte
sich
aber
nicht
damit,
die
Gewerbefachschule
während
der
Lehrzeit
zu
besuchen,
sondern
opferte
vier
Jahre
lang
auch
noch
die
Sonntage,
um
die
Polytechnische
Schule
mit
den
Fächern
Zeichnen
und
Modellieren
zu
absolvieren.
Dann
-
nach
Beendigung
der
Lehrzeit
-
hielt
es
ihn
nicht
länger
in
Leipzig
und
so
arbeitete
er
in
Frankfurt
(Main),
München,
Elberfeld,
Konstantinopel,
Nürnberg
und
Berlin.
Gern
erinnert
sich
der
Meister
auch
heute
noch
an
seine
Münchener
Zeit.
Zwei
Jahre
besuchte
er
dort
in
den
Abendstunden
die
Kunstgewerbeschule
und
studierte
die
Museen
dieser
einzigartigen
Kunststadt.
Sonntags
zog
er
wohl
auch
vielfach
als
Mitglied
des
Deutsch-österreich.
Alpenvereins
mit
dem
Skizzenbuch
in
die
Berge,
und
diese
Liebe
zu
den
Bergen
hat
ihn
bis
heute
nicht
verlassen.
Bedeutsam
war
für
ihn
aber
auch
die
Zeit
seiner
Tätigkeit
an
der
Münze
in
Konstantinopel.
Launig
und
Humorvoll
weiß
er
davon
zu
berichten.
Mit
160
Pfd.
Gewicht
rückte
der
25jährige
1914
als
Gardepionier
in
den
Krieg.
Beim
Deutschen
Alpenkorps
machte
er
die
Balkan-Offensive
mit,
kam
an
die
Westfront,
wurde
vor
Verdun
verschüttet
und
kehrte
nach
Lazarettaufenthalt
und
Ersatzkompanie
am
23.
Dezember
mit
einem
Gewicht
von
91
Pfund
wieder
nach
Leipzig
zurück.
Aber
wie
sah
es
mit
seinem
Beruf
aus?
Orden
und
Medaillen
wurden
nicht
mehr
gebraucht.
Aber
Johannes
Frauendorf
verzagte
nicht.
Anpassungsfähig
wie
er
zu
allen
Zeiten
gewesen
ist,
fand
er
Arbeit
als
Werkzeugmacher
in
der
Industrie
und
war
bald
ein
begehrter
Spezialist
für
Prägewerkzeuge.
Als
er
sich
1925
dann
selbständig
machte,
wurde
er
insbesondere
durch
Aufträge
der
Polizei
und
Reichswehr
auf
das
Gebiet
der
Zinnfigur
gedrängt,
wobei
es
sich
jedoch
zunächst
vorwiegend
um
Figuren
für
Demonstrations-
und
Unterrichtszwecke
handelte,
die
also
keine
uniformkundliche
Genauigkeit
erforderten.
Diese
Spezialkenntnisse
eignete
sich
der
"J.
F."
signierende
Kunsthandwerker
jedoch
insbesondere
durch
die
unermüdlichen
Bemühungen
des
hochverdienten
Albert
Lockwood,
der
damals
in
Chemnitz
wohnte,
bald
an.
Vor
allen
Dingen
erkannte
er
aber
sehr
richtig,
daß
er
sich
auf
eine
gewisse
Epoche
spezialisieren
müsse
und
wählte
die
Zeit
von
1812-15
von
1866-71
und
schließlich
auch
noch
die
Gebiete
bis
1916.
Daß
er
auch
für
Sammler
Formen
gravierte,
ist
bekannt,
auch
daß
diese
Figuren
anderer
Epochen
enthielten.
Aber
seine
besten
Leistungen
lagen
und
liegen
auf
den
oben
genannten
Gebieten.
Was
ist
nun
das
Besondere
an
Frauendorf
als
Graveur?
Betrachten
wir
einmal
die
Frauendorfschen
Artikel
in
unserer
"Zinnfigur",
z.
B.
in
Heft
10/1954,
S.
160.
Er
schreibt:
"Die
Zuavenjacke
ist
kurz
und
schneidet
mit
der
unteren
Kante
auf
Koppelmitte
ab."
Das
sind
exakte
Angaben,
wie
z.
B.
auch
diese:
Auf
den
Kollets
der
Preußen
standen
die
Knopfreihen
eng
zusammen,
nicht
in
Brustwarzenbreite
wie
später
bei
den
Ulanen.
Man
merkt,
daß
der
Graveur,
der
ja
auch
sein
eigener
Entwurfszeichner
ist,
ein
Mann
ist,
der
richtig
sehen
gelernt
hat.
Wie
er
das
gelernt
hat
und
es
in
Maße
umzusetzen
wußte,
ist
eine
kleine
Geschichte
für
sich.
Frauendorf
erzählt
davon:
"Da
ich
ein
armes
Luder
war,
mußte
ich
mir
alles
selber
suchen.
Außerdem
erkannte
ich
auf
den
Abendschulen,
die
ich
noch
als
Gehilfe
überall
besuchte,
daß
die
Lehrer
oft
gar
kein
Interesse
daran
hatten,
uns
etwas
zu
lehren
bzw.
uns
Hilfen
zu
geben.
Da
drückte
mir
einmal
ein
alter
Kollege
in
München
eine
alte
Schwarte
in
die
Hand,
eine
Zeichenschule
von
Polyklet,
dem
ollen
Griechen.
Diese
alte
Schwarte
war
in
einer
Verfassung,
daß
man
sie
nicht
gern
anguckte,
aber
in
ihrem
Inhalt
fand
ich
pures
Gold.
Gold
für
mich
wenigstens.
Denn
dieser
alte
Grieche
rechnete
nach
Handlängen,
Handbreiten
und
Fingerbreiten.
Dies
war
und
ist
ein
internationales
Maß,
das
niemals
wechseln
konnte,
und
nun
habe
ich,
wenn
ich
Menschen
zeichnete,
mir
diese
Maße
zueigen
gemacht.
Und
ich
bin
noch
heute
dem
alten
Polyklet
so
dankbar,
daß
er
vor
2000
Jahren
diese
Norm
gefunden
hat.
Mag
man
mich
veraltet
nennen
oder
gar
verlachen
ob
dieser
alten
Schule,
ich
habe
durch
sie
den
Weg
gefunden
zur
Formvollendung
und
Schönheit."
Und
das
andere:
Frauendorf
hat
alle
seine
Serien
so
ausgebaut,
daß
man
damit
tatsächlich
etwas
anfangen,
damit
eine
Schlacht
aufstellen
kann,
von
der
Reservestellung
bis
in
die
vorderste
Kampflinie.
Auch
ist
er
der
einzige,
der
für
1813
die
preußischen
Reserve-Regimenter
gebracht
hat,
die
zwar
-
wie
er
mal
sagte
-
kein
Mensch
haben
will
weil
sie
zu
einfach
sind,
und
doch
die
Masse
der
preußischen
Infanterie
ausmachten.
Ich
erinnere
nur
an
andere
vielseitige
und
vielfigurige
Serien,
wie
die
Attacke
der
Brigade
Bredow
bei
Mars
la
Tour,
die
angreifenden
Chasseurs
d'Afrique,
die
württembergische
und
bayrische
Infanterie
1870,
die
württembergische
Infanterie
1812/13,
die
attackierenden
preußischen
Husaren1813,
den
köstlichen
Kasernenhof
1913
und
die
großen
Serien
der
napoleonischen
Armee.
Oder
denken
wir
an
die
zivilen
Serien,
die
elsässischen
Bauern,
die
Stadtbevölkerung
aus
dem
Biedermeier
und
von
1910
und
jetzt
die
herrliche
Ratssitzung
um
1525.
Möge
Johannes
Frauendorfs
Wunsch
in
Erfüllung
gehen,
daß
er
nämlich
in
den
nächsten
65
Jahren
noch
viele
schöne
Figuren
für
uns
Sammler
schaffen
könne!
|
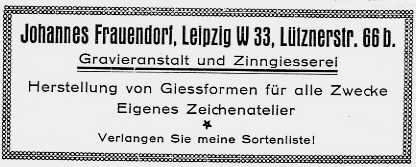 Mai, Juni, Juli 1927
Mai, Juni, Juli 1927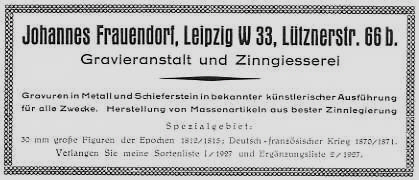 Oktober 1927
Oktober 1927